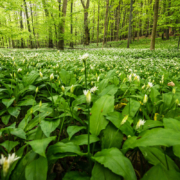Die Rose – sie ist nicht nur Symbol für Liebe, Schönheit und Zartheit, sondern auch eine echte Alleskönnerin in der Welt der Heilpflanzen. Für 2025 wurde sie zur „Heilpflanze des Jahres“ gekürt, und das aus gutem Grund: Mit ihren vielseitigen Eigenschaften ist sie eine Bereicherung für Gesundheit, Wohlbefinden und sogar die Küche.
Die Rose gehört zur Familie der Rosengewächse (Rosa species) und ist in ihrer wilden Form, wie die Hunds-Rose (Rosa canina), besonders wertvoll. Lass uns eintauchen in die faszinierende Welt dieser Heilpflanze und entdecken, wie sie dich durch das Jahr begleiten kann.
Seit jeher verstehen es Kräuterkundige, im Buch der Natur zu lesen und die Zeichen der Pflanzen zu deuten: die Gestalt, die Farbe, der Duft … sie laden uns ein, genauer hinzuschauen, bei der Pflanze zu verweilen, uns mit ihr zu verbinden und den Pflanzengeist zu erspüren. Diese sinnliche und zugleich achtsame Annäherung an das Pflanzenwesen eröffnet uns einen neuen Zugang zur Pflanzenwelt.
Wildrosenknospen-Präparat
Sobald die ersten Wildrosenknospen anschwellen und beim Aufbrechen sind, spüre ich die Kraft dieser kleinen Knospen, die den gesamten Bauplan der Wildrose in sich tragen.
Der Begriff Gemmotherapie stammt vom lateinischen gemma, was so viel wie Knospe, aber auch Juwel oder Edelstein bedeutet. Dies lässt schon erahnen, dass es sich dabei um das Edelste und Wertvollste einer Pflanze handelt. Aus den Knospen werden Auszüge hergestellt, sogenannte Gemmomazerate, die bis in unsere Zellen wirken, diese regenerieren, harmonisieren und aktivieren.
1965 wurde die Gemmotherapie ins franzö- sische und 2011 ins europäische Arzneibuch aufgenommen, aus dem auch das Grundrezept meines Wildrosenknospen-Präparates stammt. Dafür können die Seiten- und Endknospen der Heckenrose, aus denen sich die Blätter entwickeln, oder die Triebknospen verwendet werden. Die späteren Blütenknospen werden nicht verwendet.
1. Die Rose in der inneren Anwendung
Rosenblütentee
Ein Tee aus getrockneten Rosenblütenblättern ist mehr als nur ein Genuss – er wirkt ausgleichend auf Geist und Körper. Er kann bei Nervosität, Schlafproblemen und Magenbeschwerden helfen.
Rezept:
- 1 TL getrocknete Rosenblütenblätter
- 250 ml heißes Wasser (nicht kochend)
- Ziehzeit: 5–8 Minuten
Der zarte Duft wirkt beruhigend, und der Tee bringt dich in Balance.

Hagebuttentee
Wenn du dich ausgelaugt fühlst oder dein Immunsystem einen Schub braucht, ist Hagebuttentee die perfekte Wahl. Er hilft bei Erkältungen, unterstützt die Verdauung und schmeckt angenehm fruchtig.
2. Die Rose in der äußeren Anwendung
Rosenwasser für die Haut
Rosenwasser ist ein echter Geheimtipp für empfindliche Haut. Es wirkt beruhigend, klärend und spendet Feuchtigkeit. Du kannst es als Gesichtswasser, zur Erfrischung oder sogar bei Sonnenbrand einsetzen.
DIY-Tipp:
- Gieße 1 Handvoll frische Rosenblätter mit 300 ml destilliertem Wasser auf.
- Lass die Mischung kurz aufkochen und abkühlen. Danach durch ein Sieb filtern und in eine Sprühflasche füllen.
Rosenöl
Das ätherische Öl der Rose ist besonders wertvoll – es unterstützt die Hautregeneration und lindert Spannungsgefühle. Ein paar Tropfen in einem Trägeröl (z. B. Mandelöl) reichen, um ein wohltuendes Pflegeöl herzustellen.
3. Die Rose in der Küche
Ja, auch in der Küche hat die Rose einen Platz verdient! Rosenblätter verleihen Gerichten eine feine, blumige Note.
Rosenzucker
Perfekt für Desserts oder Tee:
- Mische 2 EL getrocknete, ungespritzte Rosenblätter mit 100 g Zucker.
- Lass die Mischung in einem luftdichten Glas für ein paar Tage ziehen.
Hagebuttenmarmelade
Die fruchtigen Hagebutten sind die Basis für eine vitaminreiche Marmelade, die perfekt zu Brot, Käse oder Joghurt passt.
4. Symbolik und emotionaler Wert der Rose
Die Rose ist nicht nur eine Heilpflanze, sondern auch eine Pflanze der Seele. Ihre beruhigende Wirkung und ihr betörender Duft laden dich dazu ein, innezuhalten und dich mit dir selbst zu verbinden. Ein Strauß frischer Rosen oder der Duft von Rosenöl können dir helfen, Stress abzubauen und einen Moment der Ruhe zu finden.
Fazit: Die Rose – Königin der Heilpflanzen
Ob in der Teetasse, als sanfte Pflege für die Haut oder als kleine Vitaminbombe in Form von Hagebutten: Die Rose ist eine vielseitige Begleiterin, die dich durch das Jahr 2025 führen kann. Sie erinnert uns daran, dass Heilung und Schönheit oft Hand in Hand gehen – in der Natur genauso wie in uns selbst.
Du willst mehr erfahren? Dann schau in die Ausgabe Nr. 1 des Gesundheitsboten 2025.